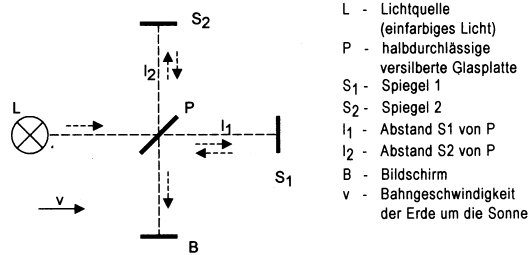
5.1 Versuchsanliegen, -aufbau und -durchführung
5.2 Herkömmliche Deutungen des Versuchsergebnisses
5.3 Ursprung und "Nützlichkeit" der Kontraktions-Hypothese
5.4 Neue Deutung des Michelsonversuchs
5.5 Nachträglich durchgeführte Versuchsvarianten
5.6 Wie man den Michelson-Versuch durchführen muß
5.7 Der "Faserkreisel" ersetzt den Michelson-Versuch
Das Michelson-Experiment, (genauer: dessen Deutung), war der Zusammenbruch eines alten und Fundament des neuen Weltbildes. Dieser Versuch, das berühmteste und folgenschwerste Experiment in der Geschichte der Physik, wurde zum Fundamental-Versuch für die Relativitätstheorie. Von Einstein und anderen Persönlichkeiten wurde dies Experiment als "Frage an die Natur" bezeichnet. Das Michelson-Experiment gilt als Beweis für das ,,Gesetz von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum", das die Menschen seit fast einem Jahrhundert je nach beruflicher und charakterlicher Veranlagung entzückt oder zur Verzweiflung bringt.
Schauen wir uns das Experiment und sein Ergebnis, das nach geläufiger moderner Sprechart "als experimentelle Erfahrungstatsache" "keiner Interpretation bedarf", doch nochmals etwas genauer an.
Zur Problemstellung des Versuches:
In der Lorentz'schen Elektronentheorie galt der Äther als unbeweglich (4.12.3). Demnach müßte sich die Bewegung der Himmelskörper (auch der Erde) gegenüber dem als ruhend gedachten Äther in Form eines möglichen Einflusses auf Mitführung und Lichtgeschwindigkeit nachweisen las sen. Den Vorstellungen über den Äther fehlte noch der direkte Nachweis seiner Existenz durch das entscheidende große Experiment.
"Der direkte Nachweis der Existenz des Äthers wäre in der Tat die Krönung des Werkes gewesen, das die besten Köpfe der Physik in 200 jähriger Arbeit geschaffen hatten." <41>
Auf welchen Annahmen und Erwartungen beruht
nun dieses Experiment?:
Man geht grundsätzlich davon aus,
daß für die Ausbreitung der Lichtwellen im Äther prinzipiell
dasselbe gilt wie für die Schallwellen in der Luft. Zur Erinnerung:
Die Schallgeschwindigkeit gegenüber Luft ist konstant c, d. h. unabhängig
von der Bewegung der Schallquelle (4.14.2).
Gegenüber einem Flugkörper, der sich relativ zur Luft in Ausbreitungsrichtung
des Schalls mit der Geschwindigkeit v bewegt, hat die Schallwelle die Geschwindigkeit
c-v. Gegenüber dem Flugkörper, der sich mit v (relativ zur Luft)
auf eine Schallwelle zubewegt, ist die Schallgeschwindigkeit c+v. Analog
wurde für die Lichtausbreitung angenommen: Die Lichtgeschwindigkeit
ist gegenüber dem Äther konstant und unabhängig von der
Bewegung der anregenden Lichtquelle und des Beobachters.
Diese Konstanz der Lichtgeschwindigkeit
ist nicht Ergebnis des Michelson Versuches; sie war eine Vorausannahme,
deren Bestätigung vom Ausgang des Experiments erwartet wurde.
Einsteins "Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum" ist da etwas grundsätzlich anderes. Von zahlreichen
Autoren wird dieser Unterschied fahrlässig oder irreführend verwischt
II(1.5).
Unter den angenommenen Voraussetzungen müßte sich die Erde, wenn die Fixsterne als Markierungen des absoluten Raumes angesehen werden, mit mindestens ihrer Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne v 30 km/s gegen über dem ruhend angenommenen Äther bewegen. Ein von der Erde in ihrer Bewegungsrichtung ausgesandter Lichtstrahl sollte demnach eine Geschwindigkeit c-v (gegenüber der Erde) und ein entgegengesetzt gerichteter Lichtstrahl die Geschwindigkeit c+v (gegenüber der Erde) haben.
Versuchsanordnung:
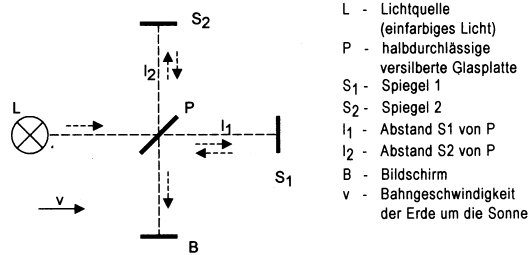
Die gesamte Versuchsanordnung ruht gegenüber der Erdoberfläche, und es wird angenommen, daß sie sich mit der Geschwindigkeit v 30 km/s mit der Erde relativ zum ,,ruhenden" Weltäther bewegt.
Von der Lichtquelle kommend, gelangt der Lichtstrahl zur halbdurchlässigen Glasplatte, die den Teilstrahl (1) zum Spiegel 1 durchläßt und einen an deren Teilstrahl (2) zum Spiegel 2 reflektiert. Nach der Spiegelung an S1 bzw. S2 interferieren beide Teilstrahlen. Die Interferenz kann in einer Anzeigeoptik beobachtet oder auf einem Bildschirm sichtbar gemacht werden.
Gefragt ist nach dem Laufzeitunterschied,
den die beiden Teilstrahlen bei ihrer Vereinigung haben (![]() t
= t1 - t2).
t
= t1 - t2).
Teilstrahl 1:
Die Zeit, in der sich der Teilstrahl 1
von der halbdurchlässigen Platte zum Spiegel Si und zurück bewegt:
t1 = t1H+t1R.
Hinlauf: Der Strahl bewegt sich
im Äther mit der konstanten Geschwindigkeit c auf sein Ziel (Spiegel
1) zu, das ihm mit der Geschwindigkeit v ,,davonläuft". Er hat bis
zum Erreichen seines Zieles den zusätzlichen Weg ![]() l
= v t1H zurückzulegen.
l
= v t1H zurückzulegen.
Dauer des Hinlaufes: ![]()
Daraus erhält man: ![]()
Das heißt: Der Lichtstrahl hat gegenüber
dem Äther die Geschwindigkeit c und legt durch die Bewegung der Versuchsanordnung
die Strecke l + ![]() l zurück.
Zur einfacheren Berechnung kann man das auch so auffassen, als ob der Lichtstrahl
lediglich die Strecke l1, aber mit kleinerer Geschwindigkeit
c-v durchläuft. Beide Betrachtungsweisen, die auf zwei völlig
unterschiedlichen Sachverhalten beruhen, führen, wie es im Modelldenken
nicht ungewöhnlich ist, zum gleichen Ergebnis.
l zurück.
Zur einfacheren Berechnung kann man das auch so auffassen, als ob der Lichtstrahl
lediglich die Strecke l1, aber mit kleinerer Geschwindigkeit
c-v durchläuft. Beide Betrachtungsweisen, die auf zwei völlig
unterschiedlichen Sachverhalten beruhen, führen, wie es im Modelldenken
nicht ungewöhnlich ist, zum gleichen Ergebnis.
Rücklauf: Der Teilstrahl bewegt
sich auf sein Ziel (die halbdurchlässige Platte) zu, das ihm mit der
Geschwindigkeit v entgegenkommt. Er hat also bis zum Erreichen dieses Zieles
nur die Strecke l1 - ![]() l
zurückzulegen.
l
zurückzulegen.
Dauer des Rücklaufes: ![]()
Durch einfaches Umstellen erhält
man: ![]()
Das heißt: Der Lichtstrahl hat in
Wirklichkeit gegenüber seinem Medium die Geschwindigkeit c und hat
im Äther, infolge der Bewegung der Versuchsanordnung, die Strecke
l1-![]() I zurückzulegen. Die gleiche
Zeit errechnet man auch, wenn man so tut, als ob der Lichtstrahl die volle
Strecke l1 mit der größeren Geschwindigkeit c + v
durchläuft.
I zurückzulegen. Die gleiche
Zeit errechnet man auch, wenn man so tut, als ob der Lichtstrahl die volle
Strecke l1 mit der größeren Geschwindigkeit c + v
durchläuft.
Somit ergibt sich die Gesamtlaufzeit für den Teilstrahl 1:
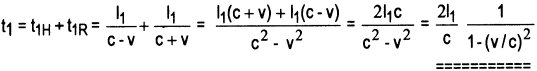
Teilstrahl 2:
t2 ist die Zeit, in der der
Teilstrahl 2 von der halbdurchlässigen Platte zum Spiegel 2 und zurück
läuft. Dabei ist zu beachten, daß sich die Versuchsanordnung
in der Zeit t2 um die Strecke vt2 weiterbewegt hat
und der Teilstrahl 2 infolge dieser Bewegung, ,,absolut" gesehen, den dargestellten
Weg nimmt.
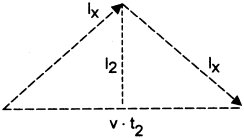
Bild 5.1.-2:Weg des Teilstrahles 2 infolge
der Bewegung der Versuchsanordnung
Voraussetzungsgemäß benötigt der Teilstrahl 2 für den zurückzulegenden Weg (2lx) die Zeit t2 = 2lx/c. Damit und aus der Darstellung 5.1.-2 ergibt sich:
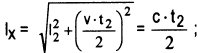 daraus
daraus 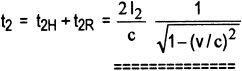
Für den Laufzeitunterschied der beiden Teilstrahlen, der für die Interferenz entscheidend ist, folgt mit l1 = l2:
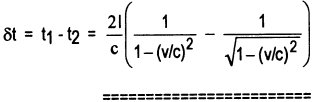
Wegen v « c entfallen die höheren Glieder der entsprechenden Taylorreihe, und es gilt die Näherung:
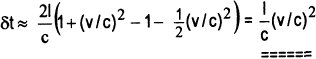
Für v ungleich 0, und es wurde ja
vorausgesetzt, daß sich die Erde mit der Geschwindigkeit v durch
den ruhenden Äther bewegt, müßte auch ![]() t
ungleich 0 sein.
t
ungleich 0 sein.
Bei v = 30 km/s und c = 300000 km/s war
aber der erwartete sehr kleine Laufzeitunterschied mit damaligen Mitteln
kaum direkt meßbar; er hätte jedoch bei Drehung der
Versuchsapparatur zu einer sichtbaren
Verschiebung der Interferenzstreifen führen müssen. Bei Drehung
der Versuchsanordnung um 90° wären beide Lichtwege vertauscht,
und die Interferenzstreifen müßten um den gleichen Betrag nach
der entgegengesetzten Seite verschoben sein. Die maximale Verschiebung
der Interferenzstreifen zu einander müßte somit insgesamt dem
doppelten Laufzeitunterschied <2![]() t)
entsprechen.
t)
entsprechen.
Außerdem hängt, wie nachweisbar
und einzusehen ist, die Verschiebung der Interferenzstreifen, also die
Empfindlichkeit der Versuchseinrichtung, von der Periodendauer bzw. der
Wellenlänge des verwendeten Lichtes ab. Es gilt also:
![]()
D. h.: Die bei Drehung der Anordnung zu
erwartende Verschiebung der Interferenzstreifen ist durch die konstruktive
Größe l und durch die Wellenlänge ![]() beeinflußbar.
beeinflußbar.
Versuchsdurchführung:
Der erste Versuch, den Michelson 1880 in
Berlin im Physikalischen Institut der Universität durchführte,
scheiterte, wie berichtet wird, an den Erschütterungen durch den Straßenverkehr.
Das zeugt zumindest davon, wie empfindlich
die Versuchseinrichtung auf äußere Einwirkungen reagierte.
Michelson wiederholte daher 1881 seine
Versuche in Potsdam. Er konnte dabei keinen Laufzeitunterschied feststellen.
Das führte man darauf zurück, daß der Lichtweg l in diesem
Versuchsapparat nur etwa 1 m betrug, die Anordnung also relativ unempfindlich
war.
1887 führte Michelson zusammen mit Morley den Versuch mit einem wesentlich präzisierten Versuchsaufbau in Cleveland (USA) erneut durch. Der Lichtweg war durch umlenkende Spiegel auf die Länge von 11 m vergrößert worden. Die ganze Anordnung war, um sie möglichst erschütterungsfrei drehen zu können, auf einer Stemmplatte montiert, die in Quecksilber schwamm. An der technischen Eignung und Leistungsfähigkeit dieser Versuchsanordnung gibt es also nicht den geringsten Zweifel.
Aber auch diesmal entsprach das Resultat keinesfalls den Erwartungen. Die lnterferenzstreifen zeigten nur ganz geringfügige, apparativ bedingte Schwankungen. Den Berichten zufolge ergab sich manchmal ein als Ätherwind deutbarer Meßwert, manchmal nicht. In keinem Falle aber stimmten die gemessenen Werte auch nur annähernd mit den nach der Theorie erwarteten überein. Der Versuch erfolgte mehrmals zu verschiedenen Jahreszeiten, also an verschiedenen Orten der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne. Er wurde später mit zunehmender Genauigkeit wiederholt.
Durch eine verbesserte Variante von Joos (1930 in Jena) hätte, wie man berichtet, ein Effekt gemessen werden können, der einer Relativgeschwindigkeit von v = 2 km/h (!) entspricht.
Das erwartete und vorausberechnete Ergebnis war nie nachweisbar. Keiner der Versuche ergab eine ausreichende Verschiebung der Interferenzstreifen und damit die beabsichtigte Bestätigung der Existenz des (ruhenden) Lichtäthers.
Der aufmerksame Leser und Mitdenker weiß inzwischen längst, daß der Michelson-Versuch, genauso wie auch die bereits in (4.11) besprochenen ,,Mitführungsversuche', unter diesen gedachten Versuchsbedingungen einer Schildbürgerei ähnelt und das erhoffte Ergebnis überhaupt nicht erbringen konnte.
Inhalt
<< (4.14) "Verqueres"
über Schwingungserzeugung und -ausbreitung
>> (5.2) Herkömmliche
Deutungen des Versuchsergebnisses